Die Migration in der Bundesrepublik begann initial mit den sogenannten Gastarbeiter*innen, die in den 1960er und 1970er Jahren angeworben wurden, um unqualifizierte Industriearbeit zu verrichten.[1] Nach einer geradezu militärisch organisierten ‚gesundheitlichen Eignungsprüfung‘ in den Heimatländern und häufig menschenunwürdigen Reisebedingungen wurden sie in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, in denen anfangs pro Person etwa vier Quadratmeter in einem 6-Personen-Zimmer vorgesehen waren. Die meisten wurden in den unteren Lohnsegmenten angestellt, machten enorm viele Überstunden und verrichteten Arbeit, die die Deutschen nicht verrichten wollten.[2]
Selbst wenn Qualifikation da war, wurde diese nahezu systematisch nicht anerkannt. Die ‚Gastarbeiter‘ erledigten ‚Ausländerjobs‘. Das führte zu einer Art statistischer Diskriminierung: Die Eigenschaften der Jobs wurden auf die Personen übertragen. Wenn ‚sie‘ diese Jobs machten, dann waren ‚sie‘ auch prädestiniert dafür. […] ‚Ausländer*innen‘ wurden in der Bundesrepublik als vorübergehende Erscheinung angesehen und – wenn sie politisch aktiv waren – als potenzielle Unruhestiftende. Sie unterstanden dem ‚Ausländergesetz‘, einer Sondergesetzgebung, die sie de facto zu Bürger*innen zweiter Klasse machte.[3]
Migration ist von Beginn an mit Unterschichtung einhergegangen und auch die Kinder der ‚Gastarbeiter*innen‘ waren überproportional stark von Armut betroffen. Die Leistungsgesellschaft war damals wie heute ein Mythos, der davon ablenkt, dass sich sozialer Status in den meisten Fällen vererbt.[4] Ende der 1970er wurden ausländische Kinder und Jugendliche auch im öffentlichen Diskurs zum ‚Problem‘ gemacht. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Albrecht Hasinger bekundete 1978 im Spiegel es entstehe ein „Problemstau, der zum sozialen Sprengsatz werden kann.“ Der Artikel stellte weiter mit Bezug auf eine kriminologische Studie von Horst Schüler-Springorum fest, dass „die ‚institutionalisierte Außenseiterrolle‘, die Sozialwissenschaftler*innen den jugendlichen Ausländer*innen attestieren, […] bislang so gut wie unbemerkt, dazu geführt [hat], daß mit deutlichem Abstand sie es sind, die im Vergleich zu allen anderen Bevölkerungsgruppen und Altersklassen mit den Strafgesetzen am ehesten und am meisten in Konflikt geraten.“[5] In den 1980er Jahren wuchs die Ausländerfeindlichkeit und es wurde ganz grundsätzlich von einem ‚Ausländerproblem‘ gesprochen. 1982 waren laut einer Infas-Umfrage etwa zwei Drittel der Deutschen dagegen, dass „Gastarbeiter, die hierbleiben wollen, die Möglichkeit erhalten, für immer hierzubleiben“.[6] 2013 hat die britische Regierung ein Dokument von 1982 freigegeben, in dem Helmut Kohl bekundete, dass es notwendig sei „die Zahl der Türken um 50 Prozent zu reduzieren“, da es „unmöglich für Deutschland [sei], die Türken in ihrer gegenwärtigen Zahl zu assimilieren.“[7]
Das Beispiel der ‚Gastarbeiter*innen‘ illustriert auf eingängige Weise, warum die immer wieder geäußerte Sorge über ‚Ausländerkriminalität‘ wesentlich auch eine Debatte über Rassismus und Kriminalität sein muss. Es wird offensichtlich, wie eine kapitalistische Dynamik – namentlich ein Hunger der deutschen Wirtschaft nach billigen Arbeitskräften und daraus resultierende Phänomene sozialer Ungleichheit – mit rassistischer Diskriminierung zusammenwirkt und am Ende ein statistisches Phänomen produziert, dass von vielen Menschen immer wieder so gelesen wird, dass Ausländer*innen nuneinmal krimineller sind als Deutsche.
Auch wenn die Bedingungen der Gegenwart anders sind als vor 40-50 Jahren sind die Mechanismen der Diskriminierung und die Kategorien von damals noch immer präsent: Es wird weiter über die besonders kriminelle Neigung von Ausländer*innen geklagt (heute besonders Geflüchteten), als Ursache immer noch über die andere ‚Kultur‘ spekuliert (heute besonders Islam) und dabei noch immer übersehen, dass die ‚Gastarbeiter*innen‘ von damals heute als Rentner*innen am unteren Rand der Gesellschaft leben, ein sehr hohes Armutsrisiko haben und ihre Kinder und Kindeskinder rassistischer Diskriminierung ausgesetzt sind.[8]
Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Er erschöpft sich nicht in Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime oder fremdenfeindlichen Äußerungen am Stammtisch. Rassismus ist mehr als die Vorurteile einzelner Menschen. Er schlägt sich in unserem Handeln, unserem Wissen über die Welt, in unserer Sozialstruktur, unseren Kindergärten, Schulen, Behörden und eben auch in unseren Gefängnissen nieder. In diesem Sinne spricht man neben rassistischen Einstellungen einzelner Personen auch von ‚institutionellem Rassismus‘. Damit bezeichnet man „Diskurse, Politiken und Praktiken von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen […], die systematisch Ausgrenzung und Diskriminierung produzieren, ohne sich explizit und vorsätzlich rassistischer Begründungs- und Deutungsmuster zu bedienen.“[9] Auch wird der Ausdruck ‚struktureller Rassismus‘ verwendet. Dabei geht es noch allgemeiner um die Struktur unserer Gesellschaft, die in hohem Maße durch soziale Ungleichheit geprägt ist. Vermögen und Einkommen sind sehr ungleich verteilt, die Chancen für sozialen Aufstieg sind äußerst gering, sozialer Status und materieller Wohlstand werden über Generationen hinweg vererbt.[10]
Rassismus ist in diesem komplexen Gefüge ein wichtiger Faktor, über den soziale Ungleichheiten zwischen Menschen produziert, reproduziert und legitimiert werden. Mit der Geburt werden Kinder anhand von historisch mehr oder minder willkürlich gewählten Merkmalen wie Staatszugehörigkeit, Hautfarbe oder Religion einer bestimmten Gruppe zugeordnet. Diesen Gruppen wurden meistens schon vor der Geburt des Einzelnen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Dadurch werden viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, familiären Verhältnissen und Bedürfnissen in einen Topf geworfen. Die Zuschreibungen, die diese konstruierten Gruppen erhalten, haben einen großen Einfluss darauf, wie in einer Gesellschaft Ressourcen und Lebenschancen verteilt werden. Die Wissenschaft zu diesem Thema ist unmissverständlich. „Rassistische Wissensvorräte“, wie sie der Migrationsforscher Mark Terkessidis nennt, auf die wir immer wieder in Form von Vorurteilen zugreifen, erklären und legitimieren scheinbar die Benachteiligungen von bestimmten Menschen.
Das bewirkt, dass Menschen je nach Zugehörigkeit zu dieser oder jener Gruppe sehr unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Die Chancen im Bildungssystem, auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt sind ungleich verteilt. Ausländische Nachnamen erschweren die Suche nach Mietwohnungen, Kinder mit Migrationshintergrund werden in der Schule systematisch unterschätzt und sind später im Niedriglohnsektor über- und in Führungspositionen unterrepräsentiert.[11]
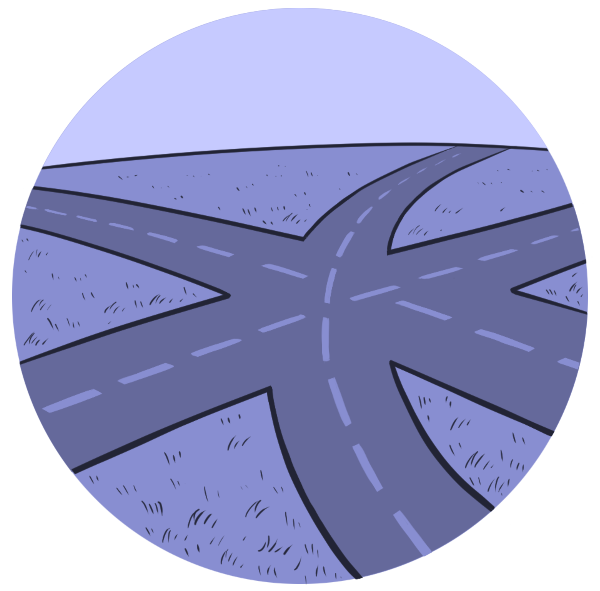
In Deutschland galt für die längste Zeit beim Staatsbürgerrecht allein das ius sanguinis (Recht des Blutes). Dieses Abstammungsprinzip, nach dem man nur deutsch sein kann, wenn die Eltern deutsch waren, entspricht einem völkisch-nationalen Verständnis des Staatsvolks. Seit einer Gesetzesreform im Jahr 2000 wurde es durch das ius soli (Recht des Bodens) ergänzt. Demnach können heutzutage in Deutschland geborene Kinder unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit durch ihre Geburt in Deutschland erlangen.[12] Die Kategorie ‚Ausländer*in‘ umfasst also ebenso Menschen, die hier geboren wurden, wie Menschen, die übers Mittelmeer und Südeuropa nach Deutschland geflüchtet sind oder solche, die letzten Monat für einen Job nach Deutschland gezogen sind; gleichermaßen Österreicher*innen, Japaner*innen, Afghan*innen wie Staatenlose. Trotz dieser unüberschaubaren Vielfalt an Menschen und Geschichten suggeriert die Gruppenbezeichnung ‚Ausländer*in‘ Gemeinsamkeiten, die über den Besitz eines Stück Papiers hinausgehen.
Das drückt sich etwa in einer weit verbreiteten generellen ‚Ausländerfeindlichkeit‘ aus, die sich – ginge es nach der Definition – eben auf alle Menschen in dieser konstruierten Gruppe beziehen müsste. Im Alltagsgebrauch wird jedoch deutlich, dass sich Ablehnung und Diskriminierung in erster Linie auf Menschen bezieht, die nicht ‚deutsch aussehen‘. Gut-situierte, weiße Ausländer*innen etwa aus Österreich oder Norwegen haben selten unter rassistischer Gewalt oder strukturellem Rassismus zu leiden.[13]
Mit der wachsenden Vielfalt der Gesellschaft, in der die Nachkommen von Migrant*innen in der 2. oder 3. Generation aufwuchsen, wurden Menschen mit diesem Hintergrund zusehends ‚unsichtbar‘ für die Statistik. Daher wurde im Jahr 2005 der Migrationshintergrund als offizielle statistische Größe in Deutschland eingeführt, um Integrationsverläufe über mehrere Generationen sichtbar zu machen. Die heutige Definition besagt, dass eine Person selbst oder mindestens ein Elternteil ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist. Dies sind nach heutigem Stand etwa 25 % der deutschen Bevölkerung, von denen etwa 52 % Deutsche und 48 % Ausländer*innen sind.[14]
Deniz Yıldırım von Citizens for Europe schreibt: „Was aber unsichtbar bleibt: Diese Menschen haben zig verschiedene Nationalitäten, Muttersprachen, Religionen, Herkunftsländer, Milieuzugehörigkeiten. Im Mainstream denken wir nur an ein paar wenige Gruppen: etwa türkisch, arabisch, polnisch, russisch. Trotzdem kann der Begriff dazu beitragen, Diskriminierung sichtbar zu machen, etwa beim Zugang zum Wohnungs- oder Arbeitsmarkt. Man muss dabei aber immer seine Grenzen bedenken.“[15]
Am Beispiel des ‚Migrationshintergrunds‘ lässt sich ein bedeutsames Dilemma von emanzipatorischem Aktivismus und wissenschaftlicher Forschung zu Rassismus und Diskriminierung verdeutlichen:
Während Befürworterinnen und Befürworter dieses Begriffs auf seine Notwendigkeit hinweisen, um die Diskriminierung auch der Kinder und Enkel von Migrantinnen und Migranten sichtbar machen zu können, kritisieren seine Gegnerinnen und Gegner, dass damit die Nachkommen ehemaliger Migrantinnen und Migranten über Generationen hinweg aus der deutschen Gesellschaft hinausdefiniert werden.[16]
Man muss sich bei der Verwendung der Kategorie und der entsprechenden Erhebung von Daten also stets die Frage stellen, ob man nicht genau jene Ungleichheiten reproduziert, die man eigentlich zu überwinden trachtet. Auf der einen Seite des Dilemmas steht die Gefahr, Kategorien aufrechtzuerhalten, über die Menschen diskriminiert werden, während bei der Vermeidung der Kategorien tatsächliche Diskriminierung unsichtbar oder verschleiert werden kann. Der ‚Migrationshintergrund‘ ist als Erfindung des Statistischen Bundesamts zur Identifikation von Rassismus letztlich mit den gleichen Schwächen behaftet wie die Kategorie ‚Ausländer*in‘.[17] Daher wird seit einiger Zeit in verschiedenen Gesellschaftsbereichen die Erhebung von differenzierten Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten gefordert.[18] Auf der Grundlage von Überlegungen, die in den letzten Jahrzehnten unter dem Begriff der ‚Intersektionalität‘ diskutiert wurden, soll eine mehrdimensionale Analyse sozialer Ungleichheit möglich werden:
So kann jemand zum Beispiel zugleich Frau, Schwarz, Muslima und Angestellte sein. In Bezug auf Diskriminierung bedeutet das, dass Personen häufig von verschiedenen Diskriminierungsformen gleichzeitig betroffen sind. Dem will der Begriff Intersektionalität Rechnung tragen. Er ist vom englischen Begriff ‚intersection‘ abgeleitet und heißt in der wörtlichen Übersetzung etwa so viel wie ‚Überschneidung‘. Bezogen auf Diskriminierung bedeutet das, dass die oben genannte Frau zugleich Opfer von Sexismus, Rassismus und Klassismus sein kann. Man kann daher in diesem Zusammenhang auch von Mehrfachdiskriminierung sprechen. Dennoch addieren sich die Diskriminierungsformen nicht einfach. Sie entwickeln eine eigene Dynamik. Sie sind sozusagen mehr als die Summe ihrer Teile und verschmelzen zu spezifischen Diskriminierungserfahrungen.[19]
Die Erfassung entsprechender Daten erfordert anders als bei ‚Ausländer*in‘ oder ‚Migrationshintergrund‘ daher auch unbedingt, dass die Fremdzuschreibungen, die Betroffene von Diskriminierung erfahren, genauso erfasst werden wie die Selbstidentifikation.
Wie eingangs beschrieben wurde, muss man unbedingt verstehen, dass Rassismus mehr umfasst als das individuelle Vorurteil oder die bewusst diskriminierende Handlung einzelner Personen. Redet man über institutionellen Rassismus, muss man darüber reden, welche Wissensvorräte innerhalb von Institutionen vorhanden sind und wie in diesen gehandelt wird. Besonders solche Institutionen, in denen in besonderem Maße Macht ausgeübt wird, brauchen eine Kultur der kritischen Selbstreflexion. So gilt es etwa zu fragen, wie Lehrer*innen benoten oder Schulempfehlungen aussprechen, wie Bewerbungs- und Berufungsverfahren gestaltet werden, wie Polizeikontrollen durchgeführt werden, wie vor Gericht und wie im Gefängnis gehandelt wird. Ausgerüstet mit den vorangegangenen Überlegungen zu den teilweise subtilen Mechanismen rassistischer Diskriminierung und zu den Kategorien, die uns alle in unterschiedliche Gruppen innerhalb einer Bevölkerung einteilen, lässt sich nun differenzierter erörtern, was eigentlich gesagt wird, wenn man von ‚kriminellen Ausländern‘ redet.
Wir wissen, dass ‚Ausländer*innen‘ – also jene Menschen ohne die Staatsbürgerschaft des Landes, in dem sie leben – in fast allen Ländern der Europäischen Union gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung im Gefängnis stark überrepräsentiert sind und dass dieser Wert seit vielen Jahren steigt. Auch in Deutschland liegt der Wert bundesweit etwa bei 30 %, wobei in Bundesländern wie Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern nur 10-15% und in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin etwas über 50 % der Gefangenen keine deutsche Staatsbürgerschaft haben.[20] Rechtspopulistische und rechtsextreme Politiker*innen benutzen diese Zahlen regelmäßig, um ihre rassistische Ideologie zu verbreiten und zu behaupten. dass Ausländer*innen oder Menschen mit Migrationshintergrund besonders kriminell seien. Haben die Nationalsozialist*innen noch eine biologistisch begründete Rassentheorie bemüht, arbeiten die Rassist*innen der Gegenwart mit der Kategorie der ‚Kultur‘, um diesen Zusammenhang zu konstruieren. Sie gehen davon aus, dass Völker unveränderliche kulturelle Identitäten besitzen und die Unterschiede zwischen ihnen so groß seien, dass ein friedliches Miteinander nicht möglich sei. Diese Theorie wird in der Forschung auch als „Rassismus ohne Rassen“, „Kulturalismus“ oder in der Sprache der Neuen Rechten als „Ethnopluralismus“ bezeichnet.[21]
Auf die Frage, warum der Ausländer*innenanteil in den Gefängnissen so hoch ist, antworten rechte Politiker*innen also damit, ‚Ausländer‘ seien besonders kriminell, weil das ihrer Gruppenzugehörigkeit (früher Rasse, heute Kultur) entspreche. Auch wenn diese Antwort jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehrt, ist sie nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt als politische Meinung existent und mal mehr und mal weniger explosiv und tödlich.
Eine andere Antwort auf die Frage, warum der Anteil so hoch ist, könnte lauten: ‚Ausländer*innen sind im Gefängnis, weil sie Ausländer*innen sind.‘ Damit ist nicht gesagt, dass sie kriminell wurden, weil sie Ausländer*innen sind, sondern dass sie eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, ins Gefängnis zu kommen, weil sie ‚ausländerspezifische‘ Lebenserfahrungen machen. Das kann neben schwierigen Sozialisationsverhältnissen, Diskriminierungserfahrungen in Schulen, verminderten Chancen auf dem Arbeitsmarkt und daraus resultierender Armut auch diskriminierende Praktiken in der Polizei und der Justiz umfassen. Die letzten beiden Faktoren führen uns zurück zu den oben besprochenen Phänomenen des strukturellen Rassismus, den Antidiskriminierungsdaten und hin zu Horst Seehofer.
Dieser hatte im Juli 2020 einer Studie über möglichen Rassismus in der Polizei eine Absage erteilt. Speziell ging es um die Frage, ob Polizist*innen racial profiling, also systematische, verdachtsunabhängige Kontrollen von Menschen aufgrund phänotypischer Erscheinung oder vermuteter Herkunft praktizieren. „Ich kann sagen, ich erkenne weder im öffentlichen Dienst noch bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem“, so Seehofer.[22] Das Innenministerium begründete die Absage der Studie damit, dass racial profiling in der polizeilichen Praxis ja bereits verboten sei. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) Sebastian Fiedler kritisierte diese Begründung in den Tagesthemen als
einigermaßen peinlich, weil sie natürlich nicht schlüssig ist. Und sie erweist den Sicherheitsbehörden selber einen Bärendienst […], weil es natürlich den Eindruck nährt, als gäbe es etwas zu verstecken. Aber die Sicherheitsbehörden selber – jedenfalls sagen das unsere Mitglieder bei den Kriminalpolizeien aus Bund und Ländern – die haben nichts zu verstecken, sondern wir haben alle einen Eid auf die Verfassung geschworen und es gibt zwei Möglichkeiten, die rauskommen können. Entweder wir stellen fest, es gibt in der Breite der Sicherheitsbehörden kein Problem. Dann ist das in Ordnung. Wenn wir aber Probleme feststellen, dann haben wir selbst ein Interesse daran, die wirklich offen zu machen und auch offensiv anzugehen.[23]
Dieses Bekenntnis zu demokratischen Grundwerten, Transparenz und der Bereitschaft zur kritischen Selbstreflektion ist vorbildlich und eine vielversprechende Grundlage für eine institutionelle Kultur, die für Reform und Innovation offen ist. Datenerhebungen selbst lösen noch keine Probleme, aber sie können die Grundlage für positive Maßnahmen bilden. Die Wahrnehmung und Sensibilität für Rassismus in der Öffentlichkeit sind in den letzten Jahren gewachsen. Auch die Verabschiedung des Landesantidiskriminierungsgesetzes im Juni 2020 in Berlin zeigt, dass Innovationen und institutionelles Umdenken möglich sind.
Es bleibt zu wünschen, dass dieses Momentum auch genutzt werden kann, um im Justizbereich etwas zu bewegen und mehr relevante Daten zu erheben und Reformen anzustoßen. Wir brauchen neben den geplanten Studien zu ‚Rassismus und Polizei‘ auch solche, die rassistische Wissensvorräte und Routinen im Justizsystem untersuchen. Wir müssen wissen, ob und wenn ja welche Auswirkungen sie auf die Praxis von Staatsanwaltschaft, Richter*innen und Mitarbeiter*innen des Strafvollzugs haben. Auch fehlen belastbare Zahlen, welche Gruppen unter diskriminierungsrelevanten Kriterien im Gefängnis überrepräsentiert sind und welche Formen der Diskriminierung sie erfahren. Zuletzt benötigen wir eine kritische Debatte über soziale Ungleichheit, über die Verteilung von Ressourcen und Lebenschancen, denn wie der deutsche Rechtswissenschaftler Franz von Liszt bereits vor über 100 Jahren sagte:
„Eine gute Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik.“[24]
1: Das erstes Anwerbeabkommen, wurde am 22. Dezember 1955 mit Italien geschlossen. Darauf folgten Anwerbeabkommen mit Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968). BPB Hintergrund aktuell, Erstes "Gastarbeiter-Abkommen" vor 55 Jahren. https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/68921/erstes-gastarbeiter-abkommen-20-12-2010
2: Jutta Höhne, Benedikt Linden, Eric Seils, Anne Wiebel Die Gastarbeiter Geschichte und aktuelle soziale Lage, in: WSI Report 16 2014. https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_16_2014.pdf
3:
Mark Terkessidis
Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute.
Hoffman und Campe Verlag, Hamburg 2019,
4:
Michael Hartman
Der Mythos von den Leistungseliten. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2002.
;
Daniel Markovits
(2019):
The Meritocracy Trap.
Penguin Press,
;
Julia Friedrich
Wir Erben: Warum Deutschland ungerechter wird, Berlin 2016.
5: Ausländerkinder - „ein sozialer Sprengsatz“, 23.10.1978. https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/40606185 https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40606185.html
6: Ausländerfeindlichkeit: Exodus erwünscht, 03.05.1982. https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14348265.html
7: Claus Hecking Kohl wollte offenbar jeden zweiten Türken loswerden, 01.08.2013. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kohl-wollte-jeden-zweiten-tuerken-in-deutschland-loswerden-a-914318.html
8: Jutta Höhne, Benedikt Linden, Eric Seils, Anne Wiebel Die Gastarbeiter Geschichte und aktuelle soziale Lage, in: WSI Report 16 2014. https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_16_2014.pdf
9: Vassilis S. Tsianos, Juliane Karakayali Rassismus und Repräsentationspolitik in der postmigrantischen Gesellschaft 18.3.2014. https://www.bpb.de/apuz/180863/repraesentationspolitik-in-der-postmigrantischen-gesellschaft?p=1
10: OECD (2018): A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
11: Julia Bernewasser Gleiche Leistung, schlechtere Note, 4. August 2018. https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-08/rassismus-schule-metwo-diskriminierung-migrationshintergrund-namen; Max versus Murat: schlechtere Noten im Diktat für Grundschulkinder mit türkischem Hintergrund Pressemitteilung vom 23. Juli 2018. https://www.uni-mannheim.de/newsroom/presse/pressemitteilungen/2018/juli/max-versus-murat-schlechtere-noten-im-diktat-fuer-grundschulkinder-mit-tuerkischem-hintergrund/; Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Diskriminierung an Schulen erkennen und vermeiden, Praxisleitfaden zum Abbau von Diskriminierung in der Schule Stand:November 2019, 4. Auflage. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/Leitfaden_Diskriminierung_an_Schulen_erkennen_u_vermeiden.pdf?__blob=publicationFile&v=4; Ausländischer Name erschwert die Wohnungssuche, Donnerstag, 30.01.2020. https://www.migazin.de/2020/01/30/umfrage-auslaendischer-name-erschwert-die-wohnungssuche/; Niedriglohnsektor für viele eine Sackgasse Freitag, 03.07.2020. https://www.migazin.de/2020/07/03/studie-niedriglohnsektor-erweist-sich-fuer-viele-als-sackgasse/; Ahyoud, Nasiha; Aikins, Joshua Kwesi; Bartsch, Samera; Bechert, Naomi; Gyamerah, Daniel; Wagner, Lucienne (2018): Wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten in der Einwande-rungsgesellschaft – eine anwendungsorientierte Einführung. Vielfalt entscheidet – Diversity in Leadership, Citizens For Europe (Hrsg.), Berlin. Online verfügbar:, https://vielfaltentscheidet.de/publikationen/
12: Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland und Europa. http://baustein.dgb-bwt.de/C7/Staatsangehoerigkeit.html
13: Leipziger Autoritarismus-Studie 2018 veröffentlicht: Fast jeder dritte Deutsche vertritt ausländerfeindliche Positionen, Pressemitteilung 2018/285 vom 07.11.2018. https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/leipziger-autoritarismus-studie-2018-langzeitstudie-mit-aktuellen-ergebnissen-zu-autoritaeren-und-re-1/
14: Ahyoud, Nasiha; Aikins, Joshua Kwesi; Bartsch, Samera; Bechert, Naomi; Gyamerah, Daniel; Wagner, Lucienne (2018): Wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten in der Einwande-rungsgesellschaft – eine anwendungsorientierte Einführung. Vielfalt entscheidet – Diversity in Leadership, Citizens For Europe (Hrsg.), Berlin. Online verfügbar:, https://vielfaltentscheidet.de/publikationen/
15: Dinah Riese, Forscherin über Migrationshintergrund: „Weg mit diesem Begriff“. https://taz.de/Forscherin-ueber-Migrationshintergrund/!5694878/
16: Vassilis S. Tsianos, Juliane Karakayali Rassismus und Repräsentationspolitik in der postmigrantischen Gesellschaft 18.3.2014. https://www.bpb.de/apuz/180863/repraesentationspolitik-in-der-postmigrantischen-gesellschaft?p=1
17:
Siehe Endnote 14.
18: Dr. Anne-Luise Baumann, Vera Egenberger, Dr. Linda Supik Erhebung von Antidiskriminierungsdaten in repräsentativen Wiederholungsbefragungen. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Datenerhebung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
19:
Siehe Endnote 14, S. 15.
20:
Der Migrationshintergrund wird im Gefängnis nicht erfasst.
21: Bastian Reichardt: Kultur statt Rasse. https://www.freitag.de/autoren/bastian-reichardt/kultur-statt-rasse
22: Handelsblatt Zu „Racial Profiling“-Studie: Seehofer sieht kein „strukturelles Problem“ im öffentlichen Dienst. 7. Jul 2020. https://www.youtube.com/watch?v=L3HbO1Ibzlw
23: "Ein Bärendienst" für die Polizei. 7. Jul 2020. https://www.tagesschau.de/inland/studie-polizei-rassismus-debatte-101.html
24:
Franz Eduard von Liszt
(1882):
"Marburger Manifest".